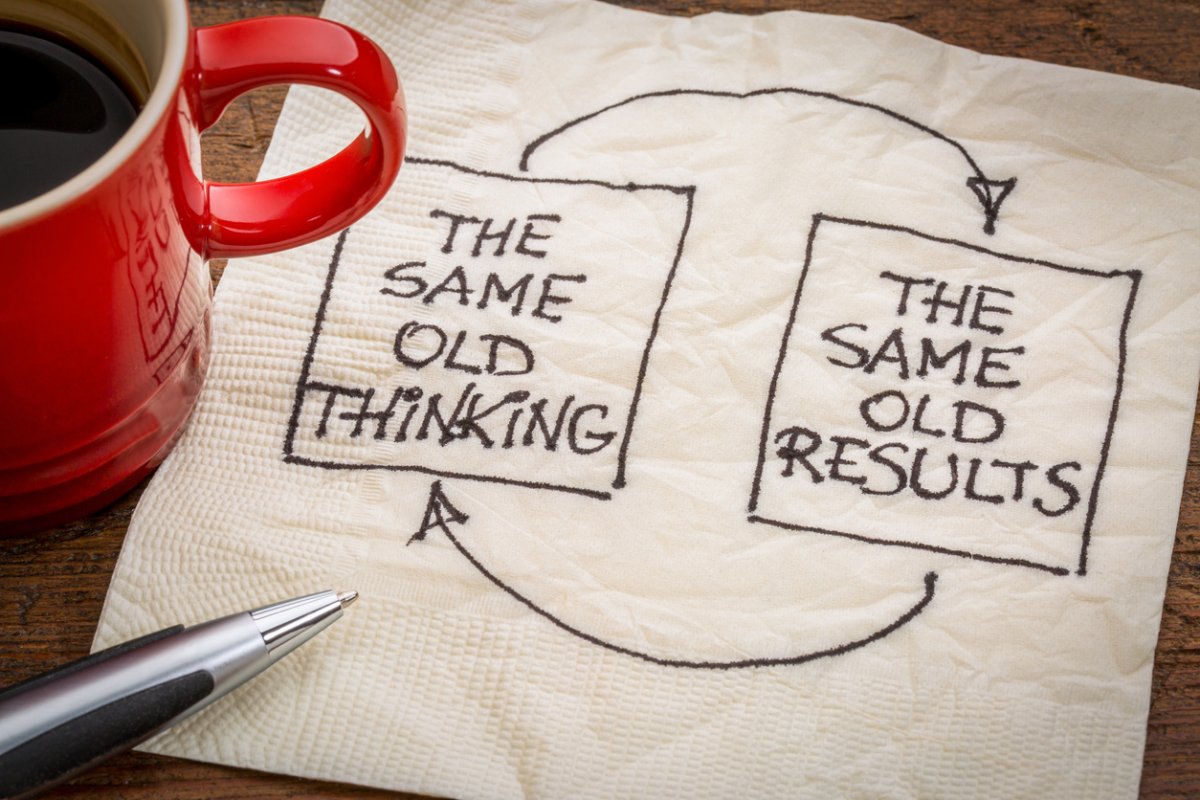Blog
Keinen Artikel mehr verpassen!
Viele Menschen sind derzeit am Limit. Ein erneuter Lockdown, Horrormeldungen jeden Tag, unterschiedlichste Sorgen und Ängste. Aufeinanderprallende Ansichten öffnen eine tiefe Kluft quer durch Familien, Freunde, Arbeitskollegen. Wer Wortmeldungen in den sozialen Medien verfolgt, dem kann eigentlich nur schlecht werden, angesichts des mittlerweile offen gezeigten Hasses von allen Seiten.
So eng die Menschen zusammengerückt sind, vor mittlerweile 21 Monaten, so weit auseinander stehen wir heute gefühlt. Was steckt hinter der Wut, dem Unverständnis, dem „Nicht-mehr-aufeinander-zugehen“? Nicht immer, aber ganz oft versteckt sich hinter der Wut die „kleine Schwester“, die Trauer. Trauer, dass nichts mehr ist, wie es war. Dass Vieles, was uns lieb und wertvoll war, verloren gegangen ist.
Ich persönlich sehe anders als die Medien keine zwei Lager, sondern ganz ganz viele Einzelschicksale, die das Verständnis füreinander verloren haben. Das, was uns beschäftigt, ist so vielfältig wie wir Menschen selbst. Nackte Angst ums Überleben. Um unsere Nächsten. Davor, wovon wir leben sollen. Was die Krise mit unseren Kindern macht. Ob wir je wieder unbeschwert leben können.
Aber anstatt das auszusprechen, direkt heraus zu sagen „mir macht Angst, dass…“, fällt es uns unglücklicherweise leichter, mit dem Finger auf andere zu zeigen, die vermeintlich schuld sind an der Misere. Die alles nicht ernst genug nehmen. Oder zu ernst. Oder irgendwo zwischendrin.
Was können wir also tun, damit wir uns zumindest von Menschen, die uns nahestehen, nicht noch weiter entfernen? Ich gebe ein paar Tipps, die aus der Paarberatung kommen, auch hier ist es ja wichtig, ins Gespräch zu kommen, anstatt die Fronten zu verhärten 😉
🔹 Oft ist es schon ein erster winziger Schritt, sich selbst zu hinterfragen: Worauf die eigene Angst oder der eigene Ärger begründet ist. Dann kann der eigene Standpunkt offener und wertschätzender, aber auch verständlicher transportiert werden.
🔹 Zusätzlich ist es natürlich auch sinnvoll, sich an der Nase zu nehmen und zu schauen, ob man dem anderen auch wirklich zuhört und bereit ist, sich auf eine andere Ansicht einzulassen, anstatt einfach abzuwinken.
🔹 Beide Ansichten zulassen: zu sagen „ich nehme deine Bedenken und deine Meinung ernst, gleichzeitig macht mir Angst, dass…“. So dürfen beide Ansichten bestehen bleiben und keine davon wird abgewertet.
🔹 Ich-Botschaften“: statt „du machst… falsch“ sagen „ich würde es besser finden, wenn du….“
🔹 Gemeinsamkeiten suchen: oft sind die Meinungen gar nicht so weit auseinander, wie man denkt, sondern es gibt durchaus Aspekte, bei denen beide gleicher Ansicht sind. So wird das Verbindende über das Trennende gestellt.
🔹 Wenn gar nichts anderes mehr geht: das Thema aussparen, wenn klar wird, dass man hier unterschiedlicher Meinung ist, auch bleiben wird, und das Gespräch nur im Streit enden würde. Es gibt ja schließlich auch noch andere Themen…
🔹 Und wenn auch das nicht funktioniert: Hilfe suchen. Dafür sind wir psychologischen Beraterinnen und Therapeuten da.
Es wäre ja schade, wenn die große C-Krise eines Tages weg ist, und mit ihr Menschen, die uns wichtig sind.
Und was kannst du für dich selbst tun in dieser Zeit? Selbstfürsorge ist das Zauberwort. Nachrichten maximal 1 x am Tag. Sich mit lieben Menschen umgeben. Auf die eigenen Bedürfnisse achten (z.B. brauche ich Ruhe, möchte ich mich austauschen, in sich hineinhorchen, das einen gerade beschäftigt, …). Raus in die Natur. Durchatmen. Den Blick auf die guten Dinge des Lebens richten.
Komm gut durch diese Zeit!
Ich glaube, vielen von euch geht es in diesen Tagen wie mir: egal, ob ich Radio höre, den Fernseher aufdrehe oder auf mein Handy schaue, in der Zeitung oder im Gespräch mit anderen - überall gibt es nur EIN Thema, und langsam möchte ich mir nur noch die Decke über den Kopf ziehen.
Horrorszenarien, gegenseitige Beschuldigungen und aufgewühlte Emotionen prasseln den ganzen Tag auf uns ein, und das betrifft nur das Corona-Thema. Da sind Klimawandel, Kriege und Naturkatastrophen noch gar nicht berücksichtigt.
Wenn man dann bedenkt, dass laut einer Studie jeder durchschnittliche Deutsche (und somit vermutlich auch jeder Österreicher) neun Stunden lang im Internet oder vor dem Fernseher hängt, kann man sich vorstellen, was das mit uns macht.
Der Fokus auf die schrecklichen Dinge, die wir jeden Tag zu hören und lesen bekommen, lassen uns glauben, dass diese Welt ein ausschließlich schlechter Ort ist. Aber die schönen Ereignisse werden nun mal nicht im Radio berichtet. Die 8.00 Uhr-Nachrichten verkünden nicht davon, dass weltweit Menschen einander helfen und beistehen. Und dass jeden Tag viele, viele schöne Dinge und manchmal auch Wunder passieren.
Was können wir aber tun gegen diese Reizüberflutung? Die negative Energie, die uns täglich begleitet?
Mein Tipp lautet, sich trotz allem mit möglichst viel Positivem, und möglichst wenig Negativem zu umgeben. Den Fokus auf alles das legen, das gut für uns und unser Gemüt ist.
Zum Beispiel:
🔸 Nachrichten streng limitieren. Vermutlich genügt es, sich einmal am Tag auf dem Laufenden zu halten, und aktuell ist es ohnehin oft so, dass die Nachrichten von zu Mittag am Abend schon wieder überholt sind.
🔸 in den sozialen Medien Seiten deabonnieren, die dich aufregen oder traurig machen, stattdessen nur das in dein Handy lassen, was dir gute Stimmung macht (Katzenkinder ;-))
🔸 Rausgehen in die Natur, möglichst ohne Handy und beobachten, was uns täglich geschenkt wird, auch an grauen Novembertagen
🔸 Sich mit guten Menschen umgeben. Welche, mit denen du dich wohlfühlst, du lachen und du selbst sein kannst
🔸 Dankbarkeit: Fokus auf das, was gut ist in deinem Leben, alle wichtigen Menschen, dein Dach über dem Kopf, dein hoffentlich gesunder Körper
Die Nachrichten werden bleiben, aber ich bin überzeugt, dass es uns zusteht, dass wir dennoch glücklich sein dürfen, und dass wir uns nach 5 Minuten Negativität zu jeder vollen Stunde wieder 55 Minuten Freude verdient haben.
Wie geht es dir mit den täglichen Schreckensmeldungen und was tust du dagegen? Lass es mich in den Kommentaren wissen
⬇️⬇️
Was ist Trauer?
In wenigen Wochen ist Allerheiligen, der Feiertag, an dem wir traditionell unserer Verstorbenen gedenken. Fragt man Menschen, womit sie das Wort „Trauer“ verbinden, ist meistens der Tod der erste Gedanke, der uns kommt.
Der Verlust von lieben Menschen. Ein Vakuum, das hinterlassen wird und das zu füllen sehr schwer ist. Jeder, der schon einmal jemanden verloren hat, weiß genau, wovon ich spreche. Die Fassungslosigkeit, die Hilflosigkeit, die endlose Traurigkeit, von der man denkt, dass sie niemals endet.
Trauer ist jedoch entgegen der landläufigen Meinung keine Krankheit, kein „psychisches Problem“, sondern die Trauerreaktion ist ein Versuch des Körpers der Selbstregulation. Jeder Trauerprozess ist individuell in seiner Dauer und Intensität. Der eine trauert ganz offensichtlich, während ein anderer die Trauer ganz mit sich ausmacht, beides sagt nichts aber über das Ausmaß des Schmerzes aus.
Wann trauern wir?
Ist der Tod von nahestehenden Menschen das einzige Ereignis, das Trauer in uns auslöst? Es ist sicher das, das von der Gesellschaft am meisten anerkannt wird, aber bei weitem nicht das einzige. Es kann uns alles in tiefe Trauer stürzen, was einen Einschnitt in unser bisheriges Leben oder einen ganz persönlichen Verlust bedeutet:
- eine Trennung oder Scheidung
- Fehlgeburt, auch in einem sehr frühen Stadium
- den Arbeitsplatz zu verlieren
- aus einem Haus, einer Wohnung ausziehen, oder an einen anderen Ort ziehen zu müssen
- wenn die Kinder erwachsen werden
- Veränderungen unseres Körpers durch Krankheit oder Unfall und auch unser eigener Alterungsprozess
- der Tod eines Tieres
- Pensionierung
- und vieles mehr
Trauer, die aus diesen Umständen heraus entsteht, hat in unserer Gesellschaft allerdings weniger Platz. Meist muss das Leben sofort weitergehen, und auch von außen kommt meist nicht so viel Hilfe und Zuspruch, weil die Trauersituation nicht so offensichtlich ist. Dennoch ist sie da. Und kostet Kraft und Energie und braucht ihre Zeit.
Was tun, wenn jemand trauert?
Menschen, die nach einem Todesfall trauern oder andere Verluste erlitten haben, werden vom Umfeld zumeist ganz besonders vorsichtig behandelt. Was soll man sagen, wenn einem die Worte fehlen? Was soll man tun, wenn man sich so hilflos fühlt? Man möchte Hilfe anbieten und trösten, und weiß doch, dass man die Last nicht abnehmen kann.
Durch Unsicherheit und Hilflosigkeit, was man tun und wie man reagieren soll, kann ein luftleerer Raum um den Betroffenen entstehen, in den niemand eindringen mag.
Was man tun kann:
- ZUHÖREN. Es bedarf nicht viele Worte, sondern zuzuhören, von dem Verlust erzählen lassen, wenn nötig, immer und immer wieder
- ehrlich sagen, wie einem zumute ist, zB „ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“
- Praktische Hilfe anbieten (kochen, einkaufen, aufräumen, Tiere versorgen, etc.), ohne beleidigt sein, wenn sie nicht angenommen wird
- Anbieten, da zu sein, und dem Betroffenen die Freiheit lassen, von selbst darauf zurückzukommen, wenn ihm danach ist
- Sich gemeinsam erinnern
Was tun, wenn man selber trauert?
- Sich selbst Zeit lassen
- sich Rückzugsräume und begrenzte Zeiträume einrichten, in denen man sich der Traurigkeit hingeben kann, z.B sich am Abend für eine Stunde an einen bestimmten Platz zurückziehen
- sich bewusst erinnern, Fotos ansehen, über den Verlust sprechen
- auf die eigenen Bedürfnisse achten (Ruhe, Rückzug, Abwechslung, sprechen, schweigen,…)
- Hilfe annehmen
Wie schon gesagt, ist Trauer grundsätzlich ein natürlicher Prozess, aber Trauer kann auch krank machen, nämlich dann, wenn sie nicht richtig verarbeitet wird. Hat man selbst oder Außenstehende das Gefühl, die Trauer lässt nicht nach, auch nicht für einzelne Momente, oder ein normales Alltagsleben ist über einen längeren Zeitraum so gut wie unmöglich, kann es sinnvoll sein, sich professionelle Unterstützung zu suchen. Eine einfühlsame Trauerbegleitung leistet hier wundervolle Dienste.
Für Fragen zur Trauer allgemein oder zur Trauerbegleitung, bitte mich gerne kontaktieren.